
Amlingstadt

 Ein beliebtes Ausflugsziel am Fuße des Fränkischen Jura, 278m über dem Meeresspiegel, 450 Einwohner, Bahnstation Strullendorf 3,5 Km; Poststelle mit öffentlichem Telefon, Kraftpostlinie Bamberg-Hollfeld-Waischenfeld. Amlingstadt ist ein ausgeprägtes Straßendorf im fränkischen Baustil am Rande des Bamberger Kessels, eingebettet zwischen sanfte Hügel, umrahmt von gesegneten Fluren. Den landschaftlichen Hintergrund des sauberen Dorfes mit seinen teils wuchtigen, teils zierlichen Fachwerkbauten und seinem gotischen Fassadenturm bilden die Vorberge des Fränkischen Jura, besonders die vielbesuchte und durch Segelflug bekannte Friesener Warte. Für die Naturfreunde ist Amlingstadt schon immer ein gern gewähltes Ausflugsziel. Nach ausgiebigen Spaziergängen durch den Hauptsmoorwald oder zur Friesener Warte bietet die herrlich gelegene Almhütte des Volks- und Gebirgstrachtenvereins "Almrausch" zur Sommerszeit gutgelagerten Trank und ländliche Spezialitäten an kalten Speisen. Jedem Besucher wird die Linde vor dem Ortseingang und der Lindenbaum am Brunnen vor dem Tore zum Kirchhofeingang, vergleichbar mit dem Volkslied "Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum" sowie die altehrwürdige Kirche immer in Erinnerung bleiben. |
 1013 wird die Siedlung erstmals als "Amelungestat" genannt in einem Tauschvertrag Kaiser Heinrichs II. von Bamberg. Die Entstehung datiert aber viel weiter zurück. 814, zur Zeit der Kirchengründung, war Amlingstadt bereits eine ansehnliche Wohnstätte. Die älteste Namensform "Amelungestat" deutet auf eine thüringische Herkunft (Hermunduren !) Gründung hin. Amalung heißt: Nachkomme des Amala, des sagenhaften Stammvaters des ostgotischen Königsgeschlechts. Vermutlich wurde Amlingstadt um 520 gegründet, als Amalaberga, die Nichte des großen Theoderich, Gemahlin des thüringischen Königs Hermenfried wurde. Das Dorf besaß fünf Urhöfe, drei waren Königsbuben, mit denen die Pfarrei dotiert war. Jede besaß ungefähr 90 Tagwerk. Die eine Hub lag hinter der Kirche. Diese als Klebhof genannt, brannte im Dreißigjährigen Krieg nieder und wurde nicht mehr aufgebaut. Die zwei anderen lagen im "Streckfuß". Die zwei übrigen Höfe wurden aller Wahrscheinlichkeit nach als Königsgut zur Errichtung des Bistums verwendet und kamen so an die bischöfliche Kammer. 1124 besaßen die zwei Höfe die beiden Ministerialien, die Brüder Christian und Marquard von Amelungestat. Um 1348 besaß sie Walter Kauershower. Diese zwei Höfe lagen rechts und links vor der Kirche. Die jetzige Pfarrkirche wurde 1442 durch Bischof Anton (von Rotenhan) persönlich geweiht. Sie hatte fünf Altäre. Der Hochaltar St. Ägidius, südlich der Muttergottes, nördlich den hl. Bekennern, in der Mitte dem heiligen Johannes dem Täufer und in der Sakristei den heiligen Jungfrauen geweiht Im Jahre 1620 war der Altar in der Mitte dem hl. Sebastian und der nördliche dem hl. Nikolaus geweiht. Im Dreißigjährigen Krieg wurde fast das ganze Dorf abgebrannt. Von den dreizehn Herdstätten der Kantorei waren zehn abgebrannt und zwei ausgestorben. Von den hinter der Vogtei Wernsdorf liegenden elf Herdstätten waren zehn abgebrannt und eine ausgestorben. Nachweisbar waren die Häuser Nr. 1-6, 27-31, 35-37 und 41 abgebrannt. Schwer hatte auch das Dorf während des Siebenjährigen Krieges zu leiden. 1759 mußte das Gotteshaus für Brandschatzung und Contribution 120 fl. an die Preußen erlegen. Der damalige Pfarrer Schütz 500 fl., die Gemeinde an Amlingstadt 1414 fl. Kein Wunder, daß damals der Chronist diesen Aufzeichnungen beifügte: "Großer Gott den Frieden doch send - deiner werten Christenheit - dafür wollen wir ohne Ende dich loben und lieben in Ewigkeit." |
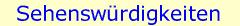 Pfarrkirche St. Ägidius. - Gründung Karls des Großen (814); der jetzige Bau um 1430 unter Oberpfarrer Johannes Schank, Stiftsdekan zu St. Gangolf in Bamberg, errichtet; 1631 von den Schweden bis auf die Mauern abgebrannt. Wiederaufbau erfolgte 1640. Um 1750/51 wurde das Kirchenschiff umgebaut, und anschließend entstanden die Rokokostukkaturen im Chor und an den Fensternischen. Der Hochaltar (mit Altarblatt) von 1752 ist ein Säulenbau aus dem Spätbarock, trägt aber auch Rokoko-Ornamentik. Beachtenswert ist der kunstvolle und reizende Drehtabernakel mit Engeln und Engelsköpfen und einem Pelikan als Aufsatz. Die Barocknebenaltäre (Apostel und Muttergottes) wurden zwischen 1660 und 1670 geschnitzt und gemalt von Georg Mitternacht zu Bamberg. Aus dem 17. Jahrhundert stammen auch zahlreiche Altarfiguren und Wandstatuen sowie das Chorgestühl mit gemalten Apostelköpfen. Lebhafte Barockgestaltung spricht namentlich aus der Figurengruppe des Apostelaltars. Äußerlich hat die Kirche gotischens Gepräge. Der 35m hohe prächtige Fassadenturm ist zur Hälfte in die Vorderfront eingeschoben und hat vier Geschosse. Der hohe beschieferte Helm mit den vier Ecktürmchen stammt vom Jahre 1655 nach dem großen Brand. An der Südecke der Turmfront links des Sakristeieingangs ein Ölbergsteinrelief aus dem Jahre 1403. Die Kirche war befestigt. Das alte Mauerwerk mußte leider wegen Einsturzgefahr erneuert werden. |